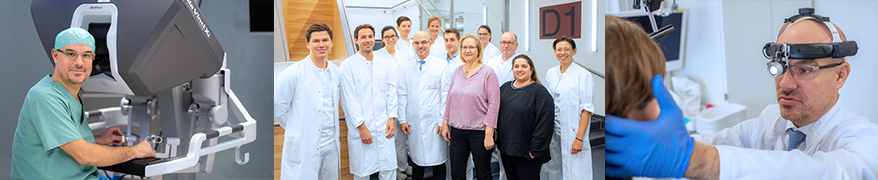Höchste Qualität Mit Liebe zum Leben
Der Kehlkopfkrebs ist ein bösartiger Tumor des Kehlkopfes und gehört zu den häufigsten Tumoren im HNO-Bereich. Die Erkrankung wird nach ihrer Lokalisation in supraglottische, glottische und subglottische Karzinome eingeteilt. Die häufigsten Risikofaktoren sind Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen, und das Erkrankungsalter liegt meist zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr.
Die Symptome eines Larynxkarzinoms hängen stark von der Tumorlokalisation ab:
- Glottische Tumoren (Stimmlippenbereich): Frühzeitige Heiserkeit oder Stimmveränderungen
- Supraglottische Tumoren (Bereich des Kehlkopfs oberhalb der Stimmlippen): Spätere Symptome wie Schluckbeschwerden (Dysphagie), Fremdkörpergefühl oder Atemnot
- Subglottische Tumoren: Oft lange unbemerkt, dann Stridor oder Atemnot
Weitere Symptome können sein:
- Hals- oder Ohrenschmerzen
- Blutiger Auswurf
- Unklare Gewichtsabnahme
- Lymphknotenschwellung am Hals
Die Diagnose erfolgt durch eine endoskopische Untersuchung mit Biopsie. Ergänzend werden bildgebende Verfahren wie CT, MRT oder PET-CT eingesetzt, um die Tumorausdehnung und eventuelle Lymphknotenmetastasen zu bestimmen.
Die Therapie des Larynxkarzinoms richtet sich nach Tumorgröße, Lokalisation, Metastasierung und Allgemeinzustand des Patienten.
Chirurgische Therapie
Kleinere Tumoren der Stimmlippen (T1/T2) können häufig mikrochirurgisch mit dem Laser entfernt werden. Hier ist die Stimme zwar beeinträchtigt (Heiserkeit), jedoch ist das Sprechen weiterhin möglich
Bei größeren oder infiltrierenden Tumoren ist eine teilweise oder vollständige Kehlkopfentfernung (Laryngektomie) notwendig. Hier bieten sich unterschiedliche Operationsverfahren an:
- Partielle Laryngektomie: Erhalt der Stimme möglich
- Totale Laryngektomie: Vollständige Entfernung des Kehlkopfes mit Anlage eines permanenten Tracheostomas zur Atemwegssicherung (dauerhafte Halsatmung)
Bei geeigneten supraglottischen Tumoren kann die TORS (transorale Roboter-assistierte Tumorresektion) eine gewebeschonende minimalinvasive Tumorresektion ermöglichen.
Neck Dissection
Fortgeschrittene Larynxkarzinome metastasieren häufig in die Halslymphknoten, insbesondere supraglottische Tumoren. Deshalb wird bei nachgewiesenen oder vermuteten Metastasen eine Neck Dissection durchgeführt.
Rekonstruktion und Rehabilitation
Nach ausgedehnten Resektionen können gestielte oder freie Lappenplastiken zur Wiederherstellung von Strukturen notwendig sein. Bei Laryngektomie erhalten Patienten eine Stimmrehabilitation mit Shunt-Ventilen (Provox-Stimmprothese) oder heutzutage eher selten notwendigen elektronischen Sprechhilfen. Somit kann man auch Menschen ohne Kehlkopf eine gesellschaftliche Teilhabe durch die Möglichkeit zu sprechen und an Unterhaltungen teilzunehmen ermöglichen.
Strahlen- und Chemotherapie
Für frühzeitig erkannte Tumoren (T1/T2) kann eine alleinige Strahlentherapie eine organerhaltende Alternative sein.
Bei lokal fortgeschrittenen Tumoren (T3/T4) oder Lymphknotenmetastasen kann eine primäre Radiochemotherapie eine Alternative zur chirurgischen Therapie darstellen. Postoperativ kann eine adjuvante Strahlen- oder Radiochemotherapie notwendig sein, insbesondere bei:
- R1-Resektion (Tumorreste im Resektionsrand)
- Lymphknotenmetastasen mit extranodaler Ausbreitung
Ernährungssicherung
Da Larynxkarzinome zu Schluckstörungen führen können, kann eine frühzeitige PEG-Sonden-Anlage erforderlich sein, um die Nahrungsaufnahme zu sichern.
Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen sind essenziell, um ein Rezidiv oder Spätfolgen frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören:
- Endoskopische Kontrolluntersuchungen
- Bildgebende Verfahren (CT, MRT, ggf. PET-CT)
- Schluck- und Stimmrehabilitation
Die Patienten werden in den ersten 2zwei Jahren alle drei Monate, anschließend halbjährlich für weitere drei Jahre in der Tumornachsorge betreut.
Zusätzlich spielen Logopädie und Ernährungsberatung eine zentrale Rolle in der Rehabilitation, um die Lebensqualität bestmöglich zu erhalten.