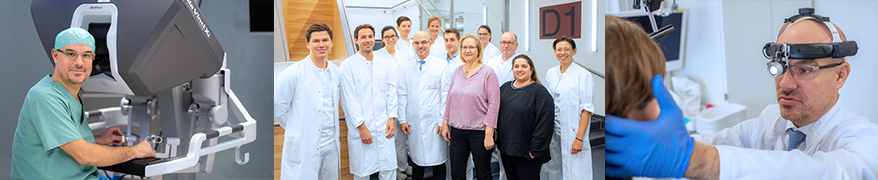Höchste Qualität Mit Liebe zum Leben
Das Mundhöhlenkarzinom ist eine bösartige Tumorerkrankung, die die Lippen, die Zunge, den Mundboden, die Wangen, den harten Gaumen oder das Zahnfleisch betreffen kann. Der häufigste histologische Typ ist das Plattenepithelkarzinom. Männer sind häufiger betroffen als Frauen, und das Haupterkrankungsalter liegt meist zwischen 50 und 70 Jahren.
- Rauchen und Alkohol (hochsummative Wirkung)
- Chronische mechanische Irritationen (z. B. durch scharfe Zahnkanten oder schlecht sitzende Prothesen)
- Mangelernährung, insbesondere Vitamin-A- und Eisenmangel
Mundhöhlenkarzinome bleiben oft lange unbemerkt, da sie zunächst schmerzlos wachsen. Folgende Symptome sollten abgeklärt werden:
- Schleimhautveränderungen, insbesondere persistierende rote (Erythroplakie) oder weiße (Leukoplakie) Verfärbungen
- Schmerzen oder Brennen in der Mundhöhle, insbesondere beim Essen
- Schluckstörungen oder Sprachveränderungen
- Nicht heilende Geschwüre oder Schwellungen
- Lockere Zähne ohne erkennbare Ursache
- Schwellungen am Hals als Zeichen von Lymphknotenmetastasen
- Klinische Untersuchung mit Inspektion und Palpation
- Biopsie zur feingeweblichen Untersuchung
- Bildgebung (CT, MRT, PET-CT) zur Bestimmung der Tumorausdehnung und Lymphknotenbeteiligung
Chirurgische Therapie
Die Operation ist die primäre Therapie bei lokalisierten Tumoren.
- Kleine Tumore können mit organerhaltenden Resektionen entfernt werden.
- Fortgeschrittene Tumore erfordern oft eine großflächige Resektion, bei der Anteile der Zunge, des Kiefers oder des Mundbodens entfernt werden müssen.
- Neck Dissection: Da Mundhöhlenkarzinome früh in die Halslymphknoten metastasieren, ist häufig eine ein- oder beidseitige operative Entfernung der Halslymphknoten notwendig.
Falls nach der Tumorresektion größere Defekte entstehen, können diese durch gestielte oder freie Lappenplastiken rekonstruiert werden, um Funktion und Ästhetik zu erhalten:
- Gestielte Lappenplastiken: Beispielsweise der FAMM-Lappen aus der Wangenschleimhaut oder bei größeren Defekten der Pectoralis-major-Lappen aus der Brustregion
- Freie Lappenplastiken: Mikrochirurgische Transplantation von Radialislappen (Unterarm), ALT-Lappen (Oberschenkel) oder Fibulalappen (Wadenbein) bei knöchernen Defekten
Strahlen- und Chemotherapie
- Eine Adjuvante Strahlentherapie bei fortgeschrittenen Tumoren oder positiven Resektionsrändern oft unablässig
- Radiochemotherapie als primäre oder palliative Therapie bei inoperablen Tumoren
Da Schluckstörungen häufig auftreten, kann vorübergehend oder dauerhaft eine perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG-Sonde) erforderlich sein.
Nach der Therapie sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen essenziell, um Rezidive oder Spätfolgen frühzeitig zu erkennen:
- HNO-endoskopische Untersuchungen & Bildgebung (CT/MRT/PET-CT)
- Logopädische und physiotherapeutische Rehabilitation zur Verbesserung von Sprache und Schluckfunktion
- Zahnärztliche Betreuung & Anpassung von Prothesen
Da die Prognose stark vom Tumorstadium bei Diagnose abhängt, ist eine frühzeitige Erkennung entscheidend.