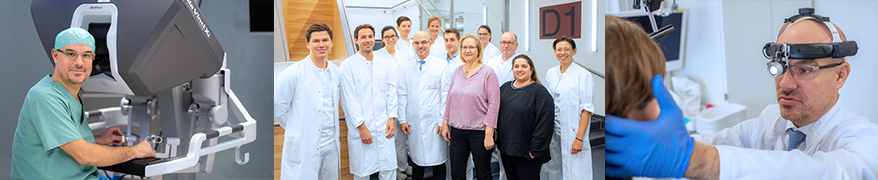Höchste Qualität Mit Liebe zum Leben
Der Rachenkrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung des Rachens und wird je nach Lokalisation in Nasenrachen- (Nasopharynx-), Mundrachen- (Oropharynx-) und Schlundrachenkrebs (Hypopharynxkarzinom) unterteilt. Hauptrisikofaktoren sind das Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum sowie Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV). Männer sind häufiger betroffen als Frauen, und das Haupterkrankungsalter liegt meist zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr.
Die Symptome eines Rachenkrebs sind oft unspezifisch und treten meist erst in fortgeschrittenen Stadien auf. Häufige Beschwerden sind beispielsweise:
- Anhaltende Halsschmerzen
- Schluckbeschwerden (Dysphagie)
- Heiserkeit oder eine Veränderung der Stimme
- Unklare Gewichtsabnahme
- Blutiger Speichel
- Eine tastbare Schwellung am Hals durch Lymphknotenmetastasen
Zur Diagnosestellung erfolgt zunächst eine klinische Untersuchung mit endoskopischer Inspektion des Pharynx und Biopsie des verdächtigen Gewebes. Ergänzend werden bildgebende Verfahren wie CT, MRT oder PET-CT zur Bestimmung der Tumorausdehnung und möglicher Metastasen eingesetzt.
Die Therapie des Rachenkrebs richtet sich nach der Tumorlokalisation, dem Tumorstadium sowie dem Allgemeinzustand von Patientinnen und Patienten.
Chirurgische Therapie
Kleinere Tumore können in einer minimalinvasiven Roboter-assistierten Resektion entfernt werden. Die Transorale Roboter-assistierte Chirurgie (TORS) ermöglicht eine präzise Tumorentfernung über die Mundhöhle mit bestmöglicher Schonung umliegender Strukturen.
Bei fortgeschritteneren Tumoren ist häufig eine ausgedehnte Resektion erforderlich. In diesen Fällen kann es notwendig sein, Gewebedefekte durch gestielte oder freie Lappenplastiken (z. B. Radialis- oder ALT-Lappen) zu rekonstruieren, um eine ausreichende Funktionalität von Schlucken und Sprache zu erhalten und den Rachen suffizient zu verschließen. Im Fall freier Lappenplastiken erfolgt die Gefäßnaht mithilfe eines Operationsmikroskops.
Da Pharynxkarzinome oft bereits Lymphknotenmetastasen im Halsbereich gebildet haben, ist häufig eine Neck dissection, also eine operative Entfernung der Lymphknoten des Halses, erforderlich. Je nach Tumorausbreitung kann diese ein- oder beidseitig und unter Mitnahme anderer Strukturen wie Muskeln, Nerven oder Gefäßen erfolgen.
In Fällen, in denen eine schwere Schwellung oder eine Atemwegsverlegung droht, kann präventiv oder therapeutisch vorübergehend oder dauerhaft ein Luftröhrenschnitt (Tracheostoma) angelegt werden, um die Atemwege dauerhaft zu sichern.
Strahlen- und Chemotherapie
Bei lokal fortgeschrittenen oder inoperablen Tumoren kann eine primäre Radiochemotherapie zum Einsatz kommen, welche als Ziel weiterhin die Heilung der Patientinnen und Patienten von ihren Tumorleiden verfolgt. Eine alleinige Strahlen- oder kombinierte Radiochemotherapie kann auch als adjuvante Therapie nach einer Operation erfolgen, insbesondere bei:
- R1-Resektionen (Tumorzellen im Resektionsrand)
- Lymphknotenmetastasen mit extranodaler Ausbreitung
Ernährungssicherung
Da Patienten mit Pharynxkarzinomen oft unter Schluckstörungen leiden, kann eine frühzeitige Anlage einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG-Sonde) erforderlich sein, um eine ausreichende Nahrungsaufnahme zu gewährleisten.
Nach abgeschlossener Therapie sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen essenziell, um ein frühzeitiges Erkennen eines Tumorrezidivs oder Spätfolgen der Behandlung zu ermöglichen. Dazu gehören:
- Endoskopische Kontrolluntersuchungen
- Bildgebende Verfahren (CT, MRT, Ultraschall, Röntgen, ggf. PET-CT)
- Überprüfung der Schluck- und Sprechfunktion
Regelhaft werden die Patientinnen und Patienten hierzu in den ersten 32 Monaten posttherapeutisch alle 3 und anschließend alle 6 Monate in strukturierten Tumornachsorgesprechstunden einbestellt.
Zudem spielt die Unterstützung durch Logopädie und Ernährungsberatung eine zentrale Rolle in der Rehabilitation, um die Lebensqualität der Patienten bestmöglich zu erhalten.